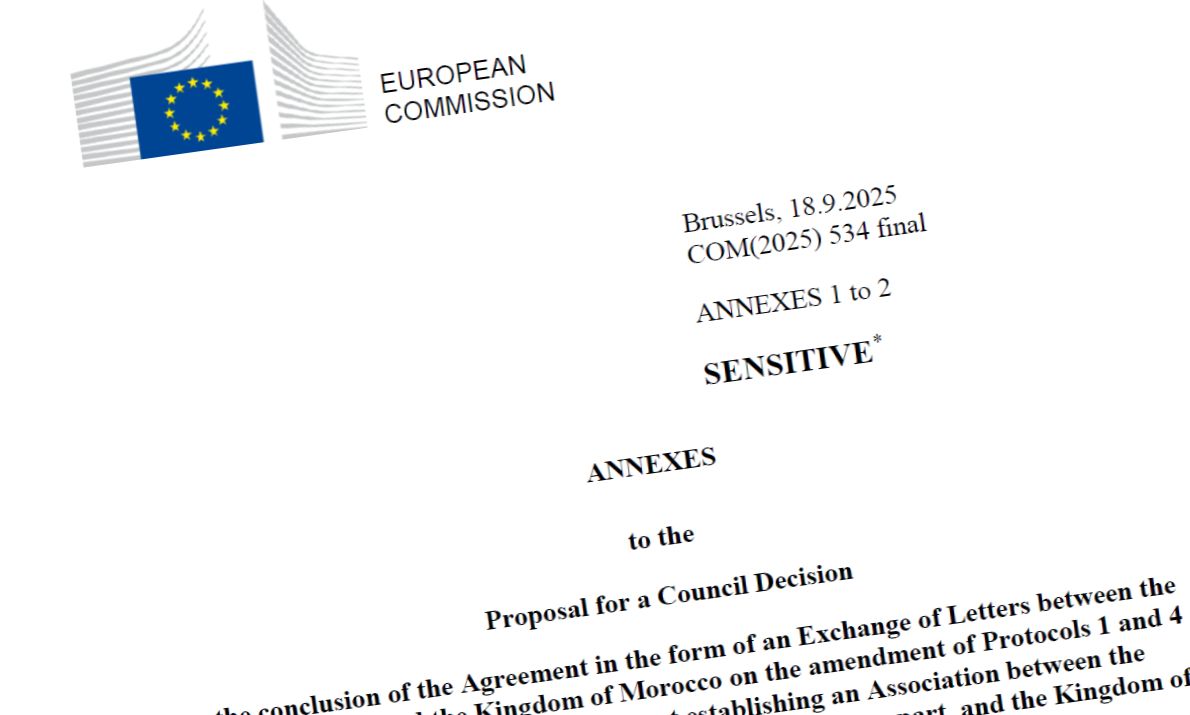In einer Anhörung im Europäischen Parlament Anfang dieser Woche äußerten sich die Abgeordneten empört darüber, dass die Kommission sie umgangen hat, um ein neues Abkommen über die besetzte Westsahara durchzusetzen, das gegen die Urteile des EU-Gerichtshofs verstößt.
Elf Monate, nachdem der Europäische Gerichtshof (EuGH) das Handelsabkommen zwischen der EU und Marokko erneut für nichtig erklärt hatte, weil es die besetzte Westsahara ohne Zustimmung der Sahrauis einbezog, stellten die Europäische Kommission und Marokko plötzlich ein neues Abkommen vor, das ihrer Meinung nach die rechtlichen Probleme „behebt“ – ein Ansatz, den sie nun auch auf ein neues Fischereiabkommen anwenden wollen.
Am 6. Oktober legte die Kommission dem Ausschuss für internationalen Handel (INTA) des Europäischen Parlaments das neue Abkommen vor – allerdings erst, nachdem es bereits vorläufig in Kraft getreten war, unter Umgehung des Kontroll- und Zustimmungsrechts des Parlaments. Dieser Schritt führte zu dieser außerordentliche Anhörung, in der die Abgeordneten ihre Frustration und Kritik zum Ausdruck brachten.
Während die Abgeordneten der Fraktionen S&D, Grüne/EFA, Die Linke und Renew die Kommission scharf kritisierten, verteidigten die rechten Mitglieder der Fraktionen ECR und PfE die Rolle Marokkos und stellten die Debatte als eine Frage der „strategischen Partnerschaft” dar. Dennoch herrschte über das gesamte politische Spektrum hinweg deutliches Unbehagen darüber, wie die Kommission den Prozess gehandhabt hatte und wie wenig transparent dieser war.
Vorläufige Anwendung löst Empörung aus
Über alle Fraktionen hinweg verurteilten die Abgeordneten die Kommission dafür, dass sie das Abkommen mit vorläufiger Anwendung, die am 3. Oktober in Kraft trat, durchgesetzt hatte, noch bevor sie die Vorschläge offiziell dem Parlament zur Zustimmung vorgelegt hatte.
Der Ausschussvorsitzende Bernd Lange (S&D, Deutschland) bezeichnete das Verfahren als „völlig inakzeptabel“ und warnte, dass es das Vertrauen des Parlaments in die Kommission untergraben könnte. Er wies die Behauptung der Kommission zurück, dass sie vor Ablauf der vom Gerichtshof gewährten Übergangsfrist am 4. Oktober 2025 unter „großem Zeitdruck” stand.
„Die von Ihnen angeführten Gründe sind nicht stichhaltig”, sagte Lange und wies darauf hin, dass das Parlament dem Abkommen mit dem Vereinigten Königreich nach dem Brexit „innerhalb von zwei Tagen” zugestimmt habe. „Zeitdruck ist keine Entschuldigung dafür, das Parlament zu ignorieren.”
Das Argument der „Dringlichkeit“ scheitert auch an Präzedenzfällen. Nachdem der EuGH im Dezember 2016 das vorherige Abkommen zwischen der EU und Marokko für ungültig erklärt hatte, wurden Produkte aus der Westsahara zwei Jahre und sieben Monate lang ohne Präferenzzölle in die EU eingeführt, bis das neue Abkommen im Juli 2019 in Kraft trat.
Fünf Tage Verhandlungen – nach einem Jahr des Schweigens
Mehrere Europaabgeordnete stellten die Frage, wie ein so komplexes Abkommen so schnell ausgehandelt werden konnte. Die ständige Berichterstatterin des Parlaments für den Maghreb, Lynn Boylan (Die Linke, Irland), erinnerte die Kommission daran, dass der INTA-Ausschuss bereits im März 2025 um eine Unterrichtung gebeten hatte, die mit der Begründung abgelehnt wurde, dass die Kommission „keine Informationen über die nächsten Schritte in Bezug auf die Westsahara-Akte habe“.
Die Verhandlungen mit Marokko dauerten Berichten zufolge nur fünf Tage (10.-15. September), was den Verdacht aufkommen ließ, dass die Gespräche möglicherweise begonnen hatten, bevor die Kommission überhaupt ein Mandat des Rates hatte.
„Sie brauchten ein Jahr, ein ganzes Jahr, bis auf ein paar Wochen, um das Urteil vollständig zu analysieren, und dann kamen Sie innerhalb weniger Wochen mit einem Mandat, einer Schlussfolgerung und einer Vereinbarung mit den marokkanischen Behörden. Wo war die Zeit, um das Europäische Parlament einzubeziehen? Und wo war die Zeit, um das zu tun, was Sie tun mussten, um die Zustimmung des sahrauischen Volkes zu erhalten?“, fragte Kathleen Van Brempt (S&D, Belgien).
Etikettierungstrick: Westsahara hinter marokkanischen Regionen versteckt
Nach der neuen Regelung erhalten Produkte aus der Westsahara die gleichen Zollpräferenzen wie marokkanische Waren und werden nach „Produktionsregion“ gekennzeichnet. Die Kommissionsbeamtin Maria Isabel García Catalán erklärte, dass auf allen „Ursprungsnachweisen, Ursprungszeugnissen, Rechnungserklärungen und in der Kennzeichnung“ ein Verweis auf „zwei Regionen, Dakhla und Laayoune“ zu finden sein werde, und bestätigte damit, dass auf Zertifikaten und Etiketten nur die von Marokko auferlegten administrativen Regionalbezeichnungen – Laayoune-Sakia el Hamra und Dakhla-Oued Eddahab – verwendet werden, ohne einen Verweis auf die „Westsahara“.
Die Abgeordneten warnten, dass dieser Ansatz im Widerspruch zu der Feststellung des Gerichtshofs steht, dass das Gebiet „gesondert und unterschiedlich” von Marokko ist, und EU-Verbraucher:innen täuscht.
„Wird dort Westsahara stehen? Ja oder nein?”, fragte Vicent Marzà Ibáñez (Grüne/EFA, Spanien). „Die Verbraucher:innen haben ein Recht darauf zu wissen, woher die Produkte stammen, die sie kaufen.”
Die Kommission ging nicht auf die praktischen Unstimmigkeiten dieses Systems ein. Die marokkanische Verwaltungsregion „Laayoune-Sakia el Hamra“ erstreckt sich teilweise bis nach Marokko hinein, während andere Teile der besetzten Westsahara verwaltungstechnisch zur Region Guelmim-Oued Noun gehören – Gebiete, die nach der Logik der Kommission als marokkanisches Hoheitsgebiet behandelt würden.
Vermutete Zustimmung und die fragwürdige Logik der „Vorteile“
Mehrere Europaabgeordnete verurteilten die Kommission dafür, dass sie erneut das sahrauische Volk ausgeschlossen hat, dessen Zustimmung der Gerichtshof wiederholt als wesentlich erachtet hat.
Florian Ermacora, GD MENA, erklärte, die Zustimmung könne „vermutet“ werden, da das Abkommen den Sahrauis „Vorteile“ bringen würde. Er fügte hinzu, dass die vom Gerichtshof festgelegten Bedingungen für eine vermutete Zustimmung durch eine Erklärung erfüllt seien, in der „die Europäische Union sich verpflichtet, die Region, d. h. die Region der Westsahara, durch die Finanzierung von Projekten in Schlüsselbereichen wie Wasser, Energie und anderen zu unterstützen“. Ermacora fuhr fort, dass sich die EU im Rahmen der Erklärung auch verpflichtet, „die humanitäre Hilfe für die Sahrauis, die sich noch in den Lagern von Tindouf befinden, fortzusetzen“ und „geeignete Programme in Bereichen wie Bildung, Qualifizierung und Kultur zu unterstützen, die sich an die Menschen des Volkes der Westsahara richten, die sich weder in der Westsahara noch in Tindouf befinden“.
Ermacora fügte hinzu, dass die Kommission „ein sehr klares Konzept“ habe, um zu überwachen, wie die Sahrauis von den Leistungen profitieren. Seine Erklärung ging jedoch nicht über vage Verweise auf die „Quantifizierung der Ressourcen“ durch einen „regelmäßigen Kontrollmechanismus“ hinaus.
Fragen, ob die Kommission überhaupt die Zustimmung des sahrauischen Volkes eingeholt hat, ob das sahrauische Volk zum Verhandlungsprozess eingeladen wurde oder an dem „regelmäßigen Kontrollmechanismus“ teilnehmen darf, blieben unbeantwortet.
Saskia Bricmont (Grüne/EFA, Belgien) warf in diesem Zusammenhang eine wichtige Frage auf: „Wie können Sie sicherstellen, dass EU-Investitionen nicht kolonialistischen Unternehmen zugutekommen, denn das könnte der Fall sein?“, fragte sie. Die Frage wurde ignoriert.
Genau das ist jedoch die Gefahr dieses Abkommens: EU-Gelder sollen in Infrastruktur- und Erneuerbare-Energien-Projekte fließen, für die Marokko seit langem EU-Unterstützung anstrebt – alles unter dem Deckmantel, „den Sahrauis zu helfen“.
Im Rahmen des neuen Abkommens werden mit EU-Geldern Energie-, Entsalzungs- und Bewässerungsprojekte in der Westsahara finanziert – Sektoren, die unter fester Kontrolle der marokkanischen Regierung und sogar der Monarchie stehen. Ein Punkt, den die Abgeordneten des Europäischen Parlaments – einschließlich derjenigen, die die Rechte der EU-Landwirt:innen verteidigen – noch nicht aufgegriffen haben, ist, dass diese Projekte den Wettbewerb mit den EU-Landwirten, die bereits unter dem Druck des Marktes zu kämpfen haben, noch verschärfen könnten. Marokko investiert derzeit massiv in windbetriebene Entsalzungsanlagen, um seine Agrarindustrie anzukurbeln, auch in der besetzten Westsahara. In den letzten Monaten wurden zwei gigantische Entsalzungsanlagen für Marokko angekündigt, die mit erneuerbaren Energien aus der besetzten Westsahara betrieben werden sollen. Ein ähnliches Projekt steht in Dakhla in der besetzten Westsahara kurz vor der Inbetriebnahme, wodurch die landwirtschaftlichen Flächen für die Exportproduktion in die EU versechsfacht werden.
Der EuGH hatte das vorherige Abkommen im Oktober 2024 aufgehoben und bekräftigt, dass die Westsahara „gesondert und unterschiedlich” von Marokko ist und dass die freie und echte Zustimmung des Volkes der Westsahara unverzichtbar ist. Der Gerichtshof ließ nur eine begrenzte „vermutete Zustimmung” zu, wenn ein Abkommen dem Volk der Westsahara – und nicht der Bevölkerung, die im von Marokko besetzten Gebiet der Westsahara lebt - keine Verpflichtungen auferlegt und ihm „aus der Nutzung der natürlichen Ressourcen des Gebiets ein präziser, konkreter, substanzieller und überprüfbarer Vorteil” erwächst, „der in angemessenem Verhältnis zum Ausmaß der Nutzung steht“. Eine Zeitleiste der EU-Gerichtsverfahren der letzten zehn Jahre finden Sie hier.
„Der Vorschlag der Kommission geht nicht nur nicht auf die Einwände des Gerichtshofs ein, sondern scheint auch die Grundlagen der Argumentation des EuGH zu ignorieren“, sagt Sara Eyckmans von Western Sahara Resource Watch. „Indem sie die Westsahara als Erweiterung Marokkos behandelt und die marokkanischen Verwaltungsgliederungen übernimmt, missachtet sie die klare Feststellung des Gerichtshofs, dass das Gebiet von Marokko gesondert und unterschiedlich ist. Die vermutete Zustimmung rechtfertigt auch nicht, das Selbstbestimmungsrecht des sahrauischen Volkes vollständig zu umgehen, noch rechtfertigt sie dessen Ausschluss von Entscheidungen, die sein Land und seine Ressourcen direkt betreffen. Damit wiederholt die Kommission nicht nur die in aufeinanderfolgenden Urteilen verurteilten Rechtsfehler, sondern untergräbt auch die Glaubwürdigkeit der EU als Verteidigerin des Völkerrechts.“
Eine vollständiges, von WSRW angefertigtes Transkript der Anhörung der EU-Kommission im INTA-Ausschuss vom 6. Oktober 2025 über das neue Handelsabkommen zwischen der EU und Marokko, das Importe aus der Westsahara betrifft, ist hier verfügbar.
Da Sie schon einmal hier sind...
Die Recherchen von WSRW werden mehr denn je gelesen und genutzt. Unsere Arbeit ist zum überwiegenden Teil ehrenamtlich, sie erfordert Zeit, Hingabe und Sorgfalt. Aber wir tun sie, weil wir glauben, dass sie wichtig ist - und wir hoffen, dass Sie das auch tun. Mit einer kleinen monatlichen Unterstützung können Sie einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Zukunft von WSRW zu sichern und dafür sorgen, dass wir weiterhin unseren komplett unabhängigen Recherchen nachgehen können.
Eine regelmäßige Spende können Sie hier einrichten. Vielen Dank!
EU-Kennzeichnungschaos erreicht bereits Supermärkte
Eine Packung Kirschtomaten aus einem französischen Supermarkt veranschaulicht die Verwirrung, die durch einen Vorstoß der Europäischen Kommission ausgelöst wurde. Diese hatte überstürzt versucht, die EU-Verbraucher- und Handelsvorschriften zu Recht zu biegen, um sie an die Territorial-Ansprüche Marokkos auf die besetzte Westsahara anzupassen.
Kommission will EU-Marokko-Handelsabkommen unter Missachtung demokratischer Prozesse und der Rechte der Sahrauis durchdrücken
WSRW veröffentlicht heute ein durchgesickertes EU-Dokument, das Pläne zur Fortsetzung des Handels mit Produkten aus der besetzten Westsahara zeigt, die einen direkten Verstoß gegen frühere Urteile des Europäischen Gerichtshofs darstellen. Die Abstimmung im EU-Rat soll schon am kommenden Mittwoch stattfinden.
Spanische Konservative fordern Ausschluss der Westsahara aus EU-Marokko-Abkommen
Die spanische Delegation der EVP-Fraktion im EU-Parlament fordert, dass die Westsahara aus dem Handelsabkommen zwischen der EU und Marokko ausgeschlossen wird.
EU strebt neue Handelsgespräche mit Marokko an – einschließlich Westsahara
Fast ein Jahr nachdem der EU-Gerichtshof das Handelsabkommen zwischen der EU und Marokko wegen der Einbeziehung der besetzten Westsahara für ungültig erklärt hat, scheint Brüssel bereit, die Grenzen des Völkerrechts erneut auszutesten.